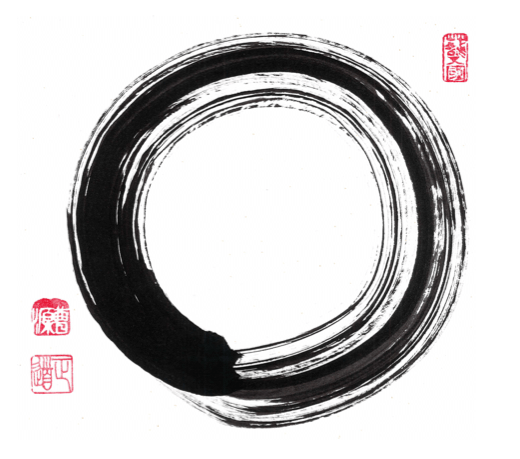Schuld und Vergebung
Teisho Schuld und Vergebung
Schuld und Vergebung zwei ganz zentrale und elementare Erfahrungen unseres Lebens - und vor allem unseres spirituellen Weges.
Lasst mich zunächst ein paar Gedanken zum Stichwort „Schuld“ versuchen.
Schon, dass ich es in Anführungszeichen setze, macht deutlich, dass ich zunächst einmal am Begriff arbeiten will.
Was meinen wir mit Schuld?
- Das ist das, wo andere sich uns gegenüber schuldig gemacht haben - jedenfalls empfinden wir das ja oft so. Wenn wir einen Verkehrsunfall haben, dann werden ein oder mehrere Schuldige gesucht. Und wenn es gut geht, findet man einen Schuldigen.
Das ist das eine, dass man immer einen Schuldigen sucht.
- Das andere ist, dass wir in jemands Schuld geraten, wir die/der Schuldige ist, sind.
- Noch eine andere Sache scheint mir wichtig, das mit den Schuldgefühlen. Dass wir uns manchmal für die Dinge schuldig fühlen, die andere gar nicht so wahrnehmen, wir aber entsetzlich darunter leiden. Und manchmal kann in solchen Situationen nur ein offeneres und ehrliches Gespräch Entlastung, Erlösung bringen.
- Schuld hat immer auch einen moralischen Akzent, wo vermeintlich „anständige“ Menschen mit dem Finger auf die zeigen, die nach ihren Kriterien sich was zu Schulden kommen liessen, die nach ihren Werten verderbte, schlechte Menschen sind.
Ja, und dann haben wir auch mit der „Schuld“ noch ein anderes Problem.
Wir alle wissen es, dass gerade im Bereich des Gesetzes, wenn es um Schuld und Unschuld geht, sehr viele Spielräume und Interpretationsmöglichkeiten da sind. Wer einmal selbst eine rechtliche Auseinandersetzung hatte, oder die von anderen miterlebt hat, der weiss wie viele Interpretationsmöglichkeiten Gesetze zulassen und wie gerecht oder ungerecht Gesetze bzw. Richtersprüche sein können. Die grössten Gauner können, wenn sie nur einen „guten“ Anwalt haben, schuldlos sein; ob sie es wirklich auch sind, und ob sie dies letztlich dann auch mit ihrem Gewissen vereinbaren können, steht auf einem anderen Blatt.
Ihr merkt, dass in diesem Zusammenhang auch sehr schnell die Frage kommen kann, wird eine Schuld jemals gesühnt werden können? Kann man eine Schuld wieder gut machen, wenn sie jenseits von materiellen Werten entstanden ist?
F. Dostojewskij geht diesem Zusammenhang in seinem Roman „Schuld und Sühne“ nach. Er beschreibt, wie der Mörder Raskolnikoff eine alte Frau brutal mit einem Beil erschlägt, nur um an ihr Geld zu kommen.
Er wird wegen des Mordes zur Zwangsarbeit nach Sibirien verurteilt.
Und da ist Marmeladow, ein Trunkenbold, den Raskolnikoff in einer schmuddligen Kneipe trifft. Der beklagt sich über die Armut, in der er leben muss. Dabei ist er derjenige, der durch seine Trunksucht die ganze Familie in den Ruin treibt.
Seine Tochter Sonja ist die einzige, die durch die Prostitution die Familie mit ihren vier Kindern über Wasser hält. Und da ist der Vater, der das letzte Geld, das seine Tochter dadurch, dass sie sich an Männer verkauft, eingebracht hat, vertrinkt.
Raskolnikoff und Sonja lernen sich kennen.
Aus einer tiefen Liebe, die der verurteilte Verbrecher weder aufnehmen noch erwidern kann, folgt sie ihm aber nach seiner Verurteilung in die Verbannung.
Und diese Liebe aber ist es, die ihn heilen wird und dazu hilft, dass er am Ende zu seiner Schuld stehen kann und gerade dadurch und darin geheilt ist.
Ihr merkt schon an den wenigen Gedanken, wie im Grunde der Begriff „Schuld“ sehr verschwommen und unklar ist.
Die grössten Ganoven können sich vom Gesetz her unschuldig fühlen, nur weil sie irgendwie es verstehen Gesetzeslücken zu finden. Wie sie dies dann mit ihrem Gewissen hinbekommen, ist eine andere Frage. Natürlich können wir uns im Äusseren rein waschen, uns der Verantwortung für das, was wir getan haben, entziehen. Aber ob wir damit wirklich schon mit unserem Gewissen im Reinen sind, ist eine ganz andere Frage.
Und sensible Menschen können Schuldgefühle haben, obwohl es dafür oftmals gar keine reale Grundlage gibt.
Ich möchte darum gerne in diesem Zusammenhang statt den Begriff Schuld eher den Begriff Verletzung einführen.
Für das, um was es mir geht, scheint mir dieser Begriff dann klarer.
Um noch einmal auf Dostojewskij‘s „Schuld und Sühne“ zurückzugreifen: In weit über 700 Seiten versucht es der Schriftsteller zu entfalten, nicht das Aufrechnen von Schuld bringt uns zurück in den offenen Raum des Lebens, sondern allein die Liebe heilt jenseits aller Schuld und Sühne unser Leben.
Manche Dinge können wir eben nicht wieder gut machen, bei noch so viel Gerechtigkeit kann man einen getöteten Menschen nicht wieder lebendig machen. Aber, alte Wunden können heilen und auch Mörder können wieder zurück ins Leben finden. Es ist möglich, dass Wunden heilen - auch wenn Narben bleiben.
Ihr merkt, mir geht es um die vielen Verletzungen, die Menschen sich ein Leben lang einander antun können, und die wir auf so ganz unterschiedliche Weise erlitten haben. Und wenn wir uns das bewusst machen, wird uns klar, dass auf dieser Ebene eben nicht durch ein berechnen oder gar aufrechnen von Schuld oder Unschuld, erlittenes Leid sich tilgen lassen kann, oder gar ,dass dadurch schon Wunden heilen könnten.
Wir können diese Erfahrungen auch deshalb nicht aufrechnen, weil sie uns oftmals die krisenhaften Momente bringen, die unser Leben noch einmal von Grund auf aufrütteln und alles Bisherige, was wir gelebt haben infrage stellen - und uns so aber auch die Möglichkeit geben, unser Leben noch einmal neu zu ordnen.
Manchmal sind es gerade auch die wirklich grossen und schweren Krisen, die unser Leben noch einmal ganz neu öffnen.
Vielleicht kennen das einige von euch?
Wie könnte man in diesem Zusammenhang dann von Schuld oder gar dem verrechnen von Schuld sprechen.
Immer wieder sagen es mir Menschen, dass die schweren Zeiten, die sie durchleben mussten, in der Situation schier unerträglich schienen und es kaum auszuhalten war, im Nachhinein es aber für sie die eigentlichen wirklich grossen und wichtigen Momente in ihrem Leben waren.
Eine kleine Geschichte dazu, in der sich oberflächlich betrachtet eine Katastrophe an die andere reiht und doch dadurch sich das Leben eines Menschen in guter Weise immer neu ausrichten kann:
Gott fügt alles wunderbar
Ein König hatte einen Minister, der bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit sagte: "Gott fügt alles wunderbar". Nach einiger Zeit hatte der König den Satz so oft gehört, dass er ihn nicht mehr ertragen konnte. Die beiden sind auf der Jagd. Der König schießt einen Hirsch. Minister und König sind hungrig, machen Feuer, grillen den Hirsch, der König beginnt zu essen und schneidet sich in seiner Gier einen Finger ab. Der Minister: "Gott fügt alles wunderbar".
Jetzt reicht es dem König. Wütend entlässt er den Minister aus seinen Diensten und befiehlt ihm, sich fortzuscheren. Er wolle ihn nie wieder sehen. Der Minister geht. Der König, gesättigt vom Hirsch, schläft ein. Wilde Räuber, Anhänger der Göttin Kali, überfallen und fesseln ihn, wollen ihn ihrer Göttin opfern - verspeisen. Im letzten Moment...bemerkt einer der Kali-Anhänger den fehlenden Finger. Die Räuber beratschlagen sich und befinden: "Dieser Mann ist unvollkommen. Ihm fehlt ein Körperteil. Unserer Göttin darf nur Vollkommenes geopfert werden." Sie lassen ihn laufen.
Der König erinnert sich an die Worte des Ministers: "Gott fügt alles wunderbar" und begreift: Genau so ist es. Auch in diesem Fall. Er fühlt sich schuldig, weil er den Minister verbannt hat und läßt ihn suchen. Nach langer Zeit wird dieser gefunden. Der König entschuldigt sich und bittet ihn, wieder in seine Dienste zu treten.
Der Minister antwortet: "Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich bin dankbar, dass du mich fortgeschickt hast. Mich hätten die Räuber geopfert. Mir fehlt kein Finger. Gott fügt alles wunderbar." (Ram Dass, 75)
„Alles fügt sich wunderbar.“ Wenn wir dahin durchdringen, wird das eine sehr wichtige und zentrale Erfahrung unseres Lebens. Weil wir dann unser Dasein als Ganzes begreifen lernen.
Wenn wir die Herausforderungen als wichtige Momente der Wandlung und Veränderung begreifen lernen, können auch die Krisen einen Sinn bekommen.
Was ich in diesem Zusammenhang meine ist, dass gerade die Menschen, die Verletzungen erfahren haben und denen es gelungen ist, die zu verarbeiten oftmals daran gereift sind und die geheilten Wunden dann ihr eigentliches „Kapital“ sein können.
Und man spürt es bei diesen Menschen, wie ihr Leben rund und weit und zur Ruhe gekommen ist - und wie umgekehrt Menschen, die durch Verletzungen verbittert und eng geworden sind, in eigenartiger Weise unreif, klein und eng wirken.
Der Therapeut Sylvester Walch, der seit vielen Jahren Holotropes Atmen anbietet und mit Menschen, die tiefe Verletzungen in ihrem Leben erfahren haben arbeitet, arbeitet mit ihnen an ihrer Heilung. Er hat seine Erfahrungen in seinem Buch „Die ganze Fülle deines Lebens“ aufgeschrieben. Ein Kapitel darin heisst, „Eine Hypothek in Kapital verwandeln“.
Ihm geht es darum, eben gerade nicht in irgendwelchen Schuldzuweisungen stecken zu bleiben, weil gerade das es ist, was unser Leben eng macht und uns negativ an die Täter bindet.
In diesem Abschnitt sagt er Folgendes:
Trotzdem sollten wir Folgendes mit berücksichtigen: Angenommen, ich erfahre, meine Frau will sich von mir trennen oder ich werde im Job entlassen oder ich bekomme die Diagnose einer schweren Krankheit. Plötzlich bin ich herausgeschleudert aus einem bis dahin vielleicht ganz gut gelebten Leben. Wenn jetzt jemand zu mir kommen und sagen würde Das wird schon sein Gutes haben, oder: Das ist Karma – was würde passieren? Ich würde mich verschließen, abwenden. Das heißt, wir sind hier in einer existenziellen Situation, in der auch Menschliches stattfindet: Kränkung, Leid, Überfordertsein, Ausweglosigkeit. Und natürlich ist es jetzt sehr wichtig, uns auf dieser Ebene mit dieser Situation auseinanderzusetzen, die Gefühle, die wir erleben, Schmerz, Traurigkeit, Ärger, zuzulassen und auszudrücken – wie es ja in den Atemsitzungen geschieht. Und es ist ungeheuer wichtig, auf dieser Ebene sich zunächst voll und ganz mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Denn nur dann, wenn wir solche Situationen in uns auch achten, diese existenzielle Gefährdung auch zulassen können, wissen wir, dass wir wieder runder werden können. Wenn wir zu früh abheben in spirituelle Erklärungen, warum das nun so ist, wird alles nur vordergründig befriedet, hängt uns aber nach und wir fühlen uns schal. Diese Auseinandersetzung dauert manchmal sehr lange, aber dann gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo sich die Situation beruhigt, denn es gibt nach Krisen immer auch eine Zeit danach. Aber Karfreitag ist nicht Ostersonntag. Und wer den Ostersonntag vorzieht, der macht den Karfreitag zunichte. Deshalb ist es wichtig, sich voll auf diesen inneren Prozess der Auseinandersetzung einzulassen, wie dies beim Holotropen Atmen geschieht. Wenn ich aber dann das Gefühl habe, es hat sich beruhigt und ich habe meine Konflikte ausgetragen, dann trete ich einen Schritt zurück. Ich gehe in die dritte Position, versuche tieferzugehen, ich stelle mir vor, wie ich meinen Scheitel öffne, mein Herz öffne, mein Zentrum spüre, den Boden fühle, der mich trägt, und ich nehme diese Situation noch einmal nach innen und frage nach, was sie mir sagen will. Was bedeutet sie für mein Leben? Wohin will sie mich führen?
Und genau an diesem Platz beginnt nun für mich das, was der Begriff VERGEBUNG signalisiert.
Noch einmal möchte ich an Dostojewskij anknüpfen:
Ihn [Raskolnikow]selbst aber liebten alle nicht, und man ging ihm aus dem Wege. Man begann ihn schließlich sogar zu hassen. Warum? Er wußte es nicht. Man verachtete ihn, lachte über ihn, und über sein Verbrechen machten sich manche lustig, die bedeutend größere Verbrechen begangen hatten als er.
(…)
Eines Tages kam es zu einem Streit – er wußte nicht einmal, aus welchem Grunde; plötzlich fielen alle wütend über ihn her. „Du bist ein Gottloser! Du glaubst nicht an Gott!“ schrien sie. „Totschlagen sollte man dich!“
(…)
Der Wachtsoldat konnte sich noch rechtzeitig zwischen ihn und den Angreifer stellen – sonst wäre Blut geflossen. Unerklärlich war für ihn auch die Frage: Warum hatten sie alle Sonja so liebgewonnen? Sie hatte sich bei ihnen nicht eingeschmeichelt; sie trafen sie selten, bloß zuweilen bei der Arbeit, wenn sie auf einen Augenblick zu ihm kam, um nach ihm zu sehen. Indessen kannten sie Sonja alle schon, wußten auch, dass sie ihm gefolgt war, wußten, wie sie lebte und wo sie wohnte. Geld hatte sie ihnen nicht gegeben, auch keine besonderen Dienste erwiesen.
(…)
Und wenn sie zu Raskolnikoffs Arbeitsplatz kam oder einer Partie Sträflingen, die zur Arbeit ging, begegnete, nahmen alle die Mütze ab und grüßten sie: „Mütterchen Sonja, du bist doch unsere liebe Mutter, du Sanfte, Barmherzige!“ sagten dann diese rohen gebrandmarkten Sträflinge zu diesem kleinen schmächtigen Geschöpfchen.
(…..)
Raskolnikoff lag die halbe Fastenzeit und die ganze Osterwoche im Krankenhaus. Schon während der Genesung begann er seiner Träume zu erinnern, die er im Fieber phantasierend gehabt hatte.
(…)
Sonja konnte ihn während seiner ganzen Krankheit nur zweimal im Hospital besuchen; man mußte jedesmal eine Erlaubnis einholen, und das war sehr schwierig. Aber sie war oft auf den Hof des Hospitals, besonders gegen Abend, unter sein Fenster gekommen, zuweilen aber auch bloß, um einen Augenblick auf dem Hof stehen zu bleiben und wenigstens von weitem nach den Fenstern seiner Abteilung zu sehen. Eines Tages war Raskolnikoff, fast schon genesen, gegen Abend wieder eingeschlafen; nach dem Erwachen trat er zufällig an das Fenster und erblickte plötzlich fern am Tore Sonja. Sie stand dort und schien auf etwas zu warten. In diesem Augenblick war es ihm, als werde sein Herz durchbohrt; er zuckte zusammen und ging schnell vom Fenster weg. Am nächsten Tag erschien Sonja nicht, auch nicht am übernächsten; er merkte, daß er sie voll Unruhe erwartete. Endlich entließ man ihn aus dem Hospital. Als er ins Gefängnis zurückkam, erfuhr er von den Sträflingen, daß Sonja krank sei, zu Hause liege und nicht ausgehe.
Er erfuhr bald, daß ihre Krankheit nicht gefährlich sei.
(…)
Als Sonja ihrerseits hörte, daß er sich so um sie grämte und sorgte, schickte sie ihm ein mit Bleistift geschriebenes Zettelchen und teilte ihm mit, daß es ihr schon viel besser gehe, daß sie nur eine leichte Erkältung habe und daß sie bald, sehr bald kommen werde, um ihn zu sehen. Als er diesen Zettel las, schlug sein Herz stark und schmerzhaft.
(…)
Am frühen Morgen, so gegen sechs Uhr, ging er zur Arbeit an den Fluß.
(…)
Raskolnikoff saß, blickte reglos hinüber, ohne sich losreißen zu können; sein Denken verwandelte sich in Träumerei, in Schauen; er dachte an nichts, aber irgendeine Schwermut lag auf ihm und quälte ihn. Plötzlich befand sich Sonja neben ihm. Sie war unhörbar herangekommen und setzte sich zu ihm. Es war noch sehr früh, die leichte Morgenkälte war noch nicht vergangen. Sie hatte ihren alten ärmlichen Mantel an und das grüne Tuch. Ihr Gesicht trug noch die Spuren der Krankheit, war magerer, blasser und schmäler geworden. Sie lächelte ihm freundlich und froh zu, aber wie gewöhnlich reichte sie ihm nur schüchtern die Hand. Sie streckte ihm die Hand immer so schüchtern entgegen, zuweilen auch gar nicht, als fürchte sie, daß er sie zurückstoßen könnte. Er nahm auch stets wie mit Widerwillen ihre Hand, begrüßte sie stets wie verdrossen; zuweilen schwieg er während ihres Besuches hartnäckig die ganze Zeit. Es kam vor, daß sie zitternd und in tiefem Kummer fortging. Jetzt aber lösten sich ihre Hände nicht; er blickte sie schnell und flüchtig an, sagte nichts und senkte den Blick zu Boden. Sie waren allein, niemand sah sie. Der Wachtposten hatte gerade kehrtgemacht. Wie es dann kam, wußte er selbst nicht, aber plötzlich war es ihm, als werde er von etwas erfaßt und zu ihren Füßen hingeworfen. Er weinte und umfaßte ihre Knie. Im ersten Augenblick erschrak sie heftig, und ihr Gesicht wurde totenblaß. Sie sprang auf und sah ihn zitternd an. Aber dann begriff sie blitzschnell alles. In ihren Augen leuchtete ein grenzenloses Glück auf; sie hatte verstanden, und es gab für sie keinen Zweifel mehr, daß er sie liebte, unermeßlich liebte, und daß dieser Augenblick endlich doch gekommen war…
Sie wollten einander wohl etwas sagen, aber sie konnten es beide nicht. Tränen standen in ihren Augen. Beide waren sie bleich und abgemagert; aber in diesen kranken und bleichen Gesichtern leuchtete schon die Morgenröte einer neuen Zukunft, der völligen Auferstehung zu neuem Leben. Die Liebe hatte sie erweckt, das Herz des einen enthielt unerschöpfliche Lebensquellen für das Herz des anderen. Sie beschlossen zu warten und auszuhalten. Sieben Jahre hatten sie noch zu warten; bis dahin aber gab es noch soviel unerträgliche Qual und soviel unermeßliches Glück! Aber er war auferstanden, und er wußte das, fühlte es ganz und gar mit seinem neuen Wesen!
(…)
Am Abend desselben Tages, als die Kasernen schon geschlossen waren, lag Raskolnikoff auf seiner Pritsche und dachte an sie. An diesem Tage schien es ihm, als ob alle Sträflinge, seine früheren Feinde, ihn mit anderen Augen ansahen. Er fing sogar selbst mit ihnen zu sprechen an, und man antwortete ihm freundlich. Er dachte darüber nach, aber es mußte wohl so sein: mußte sich denn jetzt nicht alles ändern? Er dachte an sie. Er erinnerte sich, wie er sie immer gequält und ihr Herz gepeinigt hatte; erinnerte sich ihres blassen, mageren Gesichtchens, aber sie quälten ihn jetzt fast nicht mehr, diese Erinnerungen: er wußte, mit welcher unendlichen Liebe er jetzt all ihr Leiden sühnen würde.
(…)
Auch sie war diesen ganzen Tag in großer Erregung, und in der Nacht wurde sie sogar wieder ein wenig krank. Aber sie war so glücklich, daß sie fast erschrak vor ihrem Glück. Sieben Jahre, bloß sieben Jahre! Zu Anfang ihres Glückes waren sie beide in manchen Augenblicken bereit, diese sieben Jahre als sieben Tage zu betrachten.
Ihr merkt, in diesem Sinne ist Vergebung nicht einfach nur „Schwamm drüber“, sondern ein sehr intensiver Prozess, der unser Leben öffnen kann und mich aus der Enge von Schuldzuweisungen und Schuldgefühlen befreit.
Und vor allem - und das scheint mir das allerwichtigste, es ist die Vergebung, die uns aus vielleicht manchmal lebenslangen negativen Bindungen heraus heraus holen kann.
Solange noch Menschen bei uns „eine Rechnung“ offen haben, solange sind wir an sie gebunden, sind auf ihre Enge und Kleinheit bezogen.
Erst wenn wir aus tiefsten Herzen vergeben können, werden wir die Freiheit finden, nach der wir uns sehnen.
Es geht dabei um jene Erfahrung der Liebe, in der unsere Wunden und Verletzungen heilen können. Dostojewskij hat sie eindrücklich beschrieben.
Und wenn es darum geht, dann kann dabei die Therapie eine wichtige Rolle spielen. Durch die Arbeit mit Psychologen können wir eine Menge über uns und unsere Verletzungen erfahren und verstehen lernen.
Aber die Heilung kommt aus einer anderen Ebene, die Dostojewskij in so packender Weise in seinen Romanen beschreibt und die Menschen immer wieder erfahren, wenn sie der LIEBE begegnen. Da können dann Menschen alles Gut und Böse, alles Aufrechnen, alles Werten und Richten hinter sich lassen und eine neue Art des Lebens, der Lebendigkeit beginnt.
Dostojewskij beschreibt das so:
Aber hier fängt schon eine neue Geschichte an, die Geschichte der allmählichen Erneuerung eines Menschen, die Geschichte seiner allmählichen Verwandlung, des allmählichen Überganges aus einer Welt in eine andere, der Bekanntschaft mit einer neuen, von ihm bisher völlig ungeahnten Wirklichkeit.
Anmerkung:
Es ist noch einmal eine besondere Herausforderung, in dem von mir beschriebenen Prozess der Vergebung, diesen dann auch auf sich selbst zu beziehen, also sich selbst vergeben zu können. Das ist manchmal eine noch grössere Herausforderung als anderen zu vergeben.